

Kopf-Workout: Frühjahrsputz
Unser Gehirn entspannt beim Putzen
Mit Wischer und Lappen durch die Wohnung zu gehen, kann guttun: Putzen unterstützt uns dabei, Gedanken zu ordnen, Stress abzubauen und verleiht ein Höchstmaß an Kontrolle. Mehr noch, es senkt den Cortisolspiegel, verbessert die Konzentration und kann sogar das Gehirnvolumen vergrößern.
Stimmungsheber
Besonders dann, wenn die Sonne in mein Zimmer scheint, werden gemeinerweise die Staubflusen auf dem Regal sichtbar, ebenso die Krümel auf dem Fußboden und die Schlieren am Fenster. Und schon ploppt es in einem auf: Verdammt, es ist wieder mal Zeit, sauberzumachen.
Neurobiologen haben festgestellt, dass unser Gehirn körpereigene Belohnungsstoffe ausschüttet, wenn es routiniert handeln darf, es werden Neurotransmitter wie Dopamin freizusetzen, die unsere Stimmung heben. Routinen ermöglichen es, mental Energie zu sparen und Ressourcen effizienter zu nutzen. Außerdem führt die Vorhersagbarkeit von wiederholten Handlungen, wie sie sich beim Putzen einstellen, zu einem umfassenden Gefühl der Zufriedenheit. Kurzum, wir haben uns ein Ziel gesetzt und es erreicht. Ähnlich wie beim Sport – und richtiges Durchwischen ist ja so etwas wie eine sportliche Aktivität. Und noch etwas: Beim Putzen und Aufräumen befinden wir uns außerdem in einem Setting, das uns ein Höchstmaß an Kontrolle gibt.“ Es handelt sich um die Kontrolle über die eigene Umgebung, was besonders dann beruhigend wirkt, wenn andere Lebensbereiche gerade chaotisch oder unsicher erscheinen. Da bietet das Saubermachen eine konkrete Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und sichtbar Ordnung zu schaffen.
Gehirnjogging
Außerdem kann Saubermachen von Sorgen, Grübeleien und von manchen Ängsten ablenken. Es ist nachgewiesen, dass 30 Minuten intensives, durchgängiges Putzen sogar das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen um ein Fünftel reduzieren vermag. Schon 20 Minuten intensive Hausarbeit pro Woche verringern das Risiko für Stress und Ängste um 20 Prozent. Dabei ist es aber wichtig, ins Schwitzen zu kommen.
Eine Studie der University of British Columbia, die 2021 veröffentlicht wurde, fand sogar heraus, dass regelmäßige Hausarbeit, wie Putzen oder Aufräumen, mit einem größeren Hirnvolumen verbunden ist. Die Forscher beobachteten, dass Menschen, die häufig im Haushalt aktiv sind, in bestimmten Gehirnregionen ein erhöhtes Volumen aufweisen. Besonders jene Bereiche, die mit Gedächtnis und Lernen in Verbindung stehen, wie der Hippocampus. Die Studie zeigt, dass alltägliche körperliche Aktivitäten, wie Hausarbeit, die oft nicht als „richtige“ Bewegung betrachtet werden, dennoch kognitive Vorteile haben.
Aber was kann jemand tun, der ein ausgesprochener Putzmuffel ist? Da ist es empfehlenswert, zwischendurch mal zu Wischmopp und Co. zu greifen und nicht erst dann, wenn man schon fluchend am Boden festklebt. Der Aufwand ist dann noch überschaubar.
Intervalltraining
Und was, wenn die Zeit knapp ist, was sie gefühlt meistens ist, und es Wichtigeres zu tun gibt, als gerade sauberzumachen? In diesem Fall rät die Wiener Psychologin Brigitte Bösenkopf, „strategisch vorzugehen und sich genau zu überlegen, welche Putztätigkeiten mit welchem Zeitaufwand zu schaffen sind.“ Bösenkopf hält nicht viel vom festen Plan, den viele noch aus dem Elternhaus kennen, dass zum Beispiel stets am Samstag „reinegemacht“ wird. Ihrer Erfahrung nach ist es besser, unter der Woche in kürzeren Intervallen sauberzumachen und dabei bewusst vom Alltag und den beruflichen Sorgen abzuschalten, als sich zu einer großen Hauruck-Aktion durchzuringen.

Interview mit Dr. Annegret Wolf (Institut der Psychologie Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
Warum hat Saubermachen immer noch ein so schlechtes Image?
"Es ist eine Einstellungssache. Dennoch, wir müssen den ganzen Tag über Leistungen erbringen – und auch die Wohnung sauber zu halten empfinden wir als Aufgabe. Wegen des üblichen Alltagsstresses haben wir den Kopf dafür nicht richtig frei und fühlen uns vom Saubermachenmüssen unter Druck gesetzt."
Warum ist das so?
"Ich habe in meinen Forschungen festgestellt, dass Stress das Aufschieben des Schlafengehens verstärkt: An diesen Tagen wächst das Bedürfnis, noch mehr bewusste Zeit zur Erholung zu brauchen. So wird das Zubettgehen mit Handy-Daddeln, Zappen oder Serienschauen hinausgezögert."
Umfragen ergaben, dass Frauen inmitten eines unaufgeräumten Haushalts ein höheres Level des Stresshormons Cortisol aufweisen. Haben Sie dafür eine Erklärung?
"Die University of California-Los Angeles führte dazu eine Studie durch. In der Auswertung zeigte sich, dass Frauen, die ihre Wohnungen und Häuser als nicht sauber bezeichneten, negativer gestimmt und erschöpfter waren als jene, die ihr Heim als wohligen Rückzugsort beschrieben. Man muss berücksichtigen, dass es hier um die subjektive Wahrnehmung ging. Die Schwelle, was als sauber oder schmutzig empfunden wird, ist bei jedem etwas anders ausgeprägt. Die Studie zeigte jedoch, wie viel Stress eine als unordentlich angesehene Umgebung auslösen kann. Alarmierend finde ich das Ergebnis, es betraf zumeist die Frauen, nicht die Männer.
Wie sang Johanna von Koczian in ihrem Lied: ‚Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann.‘ Das war 1977. Bis heute hat sich manches verändert und auch viele Männer putzen, doch sind immer noch überwiegend Frauen stärker in die Hausarbeit eingebunden."
Gehen Männer an die Hausarbeit anders heran als Frauen?
"Wenn wir uns das Big Five Modell der Persönlichkeit ansehen, wissen wir, dass Frauen in puncto Gewissenhaftigkeit höhere Werte aufweisen. Frauen sind meistens sorgfältiger und gründlicher beim Saubermachen als Männer. Männer haben eher eine Affinität zu technischen Geräten, sie arbeiten lieber mit schweren Geräten, also nehmen eher Bohrer oder Rasenmäher zur Hand als Staublappen oder Harke. Männer gehen oft auch analytischer an das Putzen heran. Sie sehen zum Beispiel die schmutzige Badewanne als ein Problem, das es mit System zu lösen gilt."
Fördert die technische Entwicklung zum Beispiel bei Staubsaugern die Freude am Saubermachen?
"Ich würde eher sagen, dass die technischen Innovationen das Saubermachen vor allem erleichtern. Vermutlich werden durch die High-Tech-Innovationen im Putzbereich vor allem diejenigen angesprochen oder motiviert, die sich für das Putzen weniger begeistern, aber ein Faible für technische Geräte haben! Ich kenne einige Leute, die einen Staubsauger vielleicht einmal im Monat in die Hand nahmen, nun öfter und recht begeistert dem Saugroboter bei der Arbeit zusehen und sich daran erfreuen."
Was hilft, wenn man so gar keine Lust hat?
"Zum Beispiel seine Lieblingsmusik anmachen oder sich mit einem spannenden Hörbuch ablenken. Und vielleicht gibt es einen Reiniger mit dem Geruch aus Kindheitstagen, wie Lavendel oder Zitrone, der positive Gefühle und Erinnerung auslöst. Und dann nicht vergessen, sich nach getaner Arbeit mit etwas Schönem zu belohnen!"

Wischen fürs Wohlbefinden
Für Psychologen geht dem Putzen eine sogenannte intrinsische Motivation voraus; es ist ein Handeln aus eigenem Antrieb und Interesse, ohne dass äußere Belohnungen oder Anreize eine Rolle spielen. Die „Belohnung“ liegt woanders: Eine saubere und aufgeräumte Umgebung macht zufrieden und beruhigt das Gemüt. Regelmäßiges Putzen sorgt für Struktur und Stabilität im Alltag, ist Teil der Selbstfürsorge und Ausdruck der eigenen Wertschätzung und Lebensqualität.
Einer Studie des Industrieverbands Körperpflege- und Waschmittel e.V. („So putzt Deutschland“ 2022) zufolge sorgt Putzen tatsächlich für Harmonie und Wohlbefinden: 78 Prozent der Befragten haben nach dem Saubermachen ein gutes Gefühl, etwas geschafft zu haben. 70 Prozent genießen die Sauberkeit nach dem Putzen. Die Befragten gaben an, dass Ordnung zu 77 Prozent und Sauberkeit zu 82 Prozent einen hohen Stellenwert im Alltag haben. Die positiven Effekte des Putzens lassen sich also nicht nur durch das subjektive Wohlbefinden der Befragten erklären, sondern stehen auch im Einklang mit psychologischen und neurobiologischen Erkenntnissen.

Lesezeit 10 Min.
Kopf-Workout: Frühjahrsputz
Kopf-Workout: Frühjahrsputz - Unser Gehirn entspannt beim Putzen. Dabei wischt du mehr weg, als nur den Dreck vom Boden. Mehr dazu hier.
Mehr lesen
Lesezeit 9 Min.
Entschlossen gegen HPV
HPV - Humane Papillomviren: Keine "Mädchensache". Dr. Katharina klärt auf. Mehr dazu hier:
Mehr lesen
Lesezeit 9 Min.
Bedtime Procrastination
Zu spät ins Bett, um endlich Zeit für sich zu haben und nichts mehr „müssen“ zu müssen. Bedtime Procrastination tut dir nicht gut. Mehr dazu hier.
Mehr lesen

Lesezeit 9 Min.
Architekturpsychologie
Architekturpsychologie - Warum setzen wir uns immer auf denselben Platz?
Mehr lesen
Lesezeit 10 Min.
Chaos aushalten
Chaos pur, oder nur etwas Unordnung? Jeder sieht das anders, aber eins ist gleich: Etwas Chaos auszuhalten, kann hilfreich und heilsam sein.
Mehr lesen
Lesezeit 6 Min.
Genuss
Die Fähigkeit zu genießen ist uns nicht angeboren, sondern ist ein wesentlicher Teil unserer Erziehung und Kultur. Wie du Genuss erlernen kannst erfährst du hier.
Mehr lesen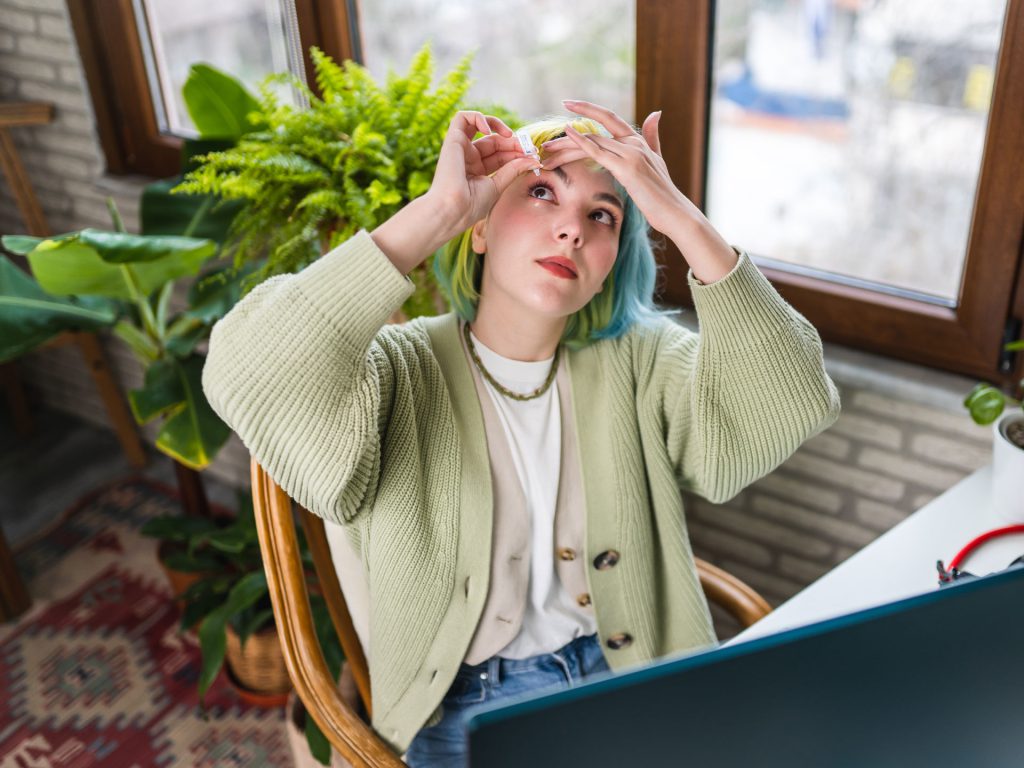
Lesezeit 3 Min.
Augenweiß durch Tropfen
Blaue Augentropfen, die für klare weiße Augen sorgen sollen! Kann man diese Tropfen bedenkenlos nehmen? Was sollte beachtet werden?
Mehr lesen
Lesezeit 5 Min.
Weinen
Weinen ist vielen Menschen unangenehm und sie versuchen, die Tränen zu unterdrücken. Doch das ist meistens die falsche Taktik.
Mehr lesen
Lesezeit 7 Min.
Präsentismus
Präsentismus beschreibt das Phänomen, dass Menschen zur Arbeit gehen, auch wenn sie krank sind. Hier erfährst du, wie man mit diesem Problem umgehen kann.
Mehr lesen
Lesezeit 7 Min.
Spielen
Spielen ist wie auf einer Insel sitzen, jenseits des Alltags. Ein Plädoyer für etwas, das unser Gehirn auf Trab hält und für gute Laune sorgt! Wie früher.
Mehr lesen
Lesezeit 7 Min.
Der Furz und was er mit sich bringt
Ungefähr einen Liter Luft pupst der Mensch durchschnittlich pro Tag. Doch was steckt dahinter? Die Geheimnisses des Furzes gibt es hier für dich zum Lesen.
Mehr lesen
Lesezeit 5 Min.
Korsett-Diät
Abnehmen durch Korsett - geht das wirklich? Was steckt hinter der Korsett-Diät? Wir zeigen was das Abquetschen der Körpermitte für Folgen hat. Mehr dazu hier.
Mehr lesen
Lesezeit 7 Min.
Keuchhusten
Das Keuchhusten eine reine Kinderkrankheit ist, ist ein gefährlicher Irrglaube. Auch Erwachsene können erkranken. Daher: Schütze dich! Mehr dazu hier.
Mehr lesen
Lesezeit 6 Min.
Shred Diät
Die Shred Diät ist der neue Trend aus den USA. Rasant Abnehmen in sechs Wochen - das ist das Versprechen. Aber wie gesund ist die Diät? Mehr dazu hier.
Mehr lesen
Lesezeit 7 Min.
Vibrionen
Auch hierzulande kann ein Bad im Meer gefährlich sein. Grund dafür sind Bakterien der Gattung Vibrio, die weltweit in Süß- und Salzwasser zu finden sind.
Mehr lesen
Lesezeit 6 Min.
Unerfüllter Kinderwunsch
Der Kinderwunsch – wenn die Qualität der Spermien zu wünschen übrig lässt, gibt es einiges, was Männer tun können, um das zu ändern. Wir geben dir Tipps.
Mehr lesen
Lesezeit 6 Min.
Reizdarm
Der Reizdarm kann dein Leben und Aktivitäten stark beeinflussen. Aber was bedeutet eigentlich Reizdarm? Wir erklären die Symptome und was du tun kannst.
Mehr lesen
Lesezeit 9 Min.
Catcalling
Sexuelle Belästigung von Frauen passiert täglich. Der Begriff dafür ist ,,Catcalling". Mag süß klingen, ist jedoch das komplette Gegenteil davon. #metoo
Mehr lesen
Lesezeit 8 Min.
Angst vor Löchern
Es gibt Menschen, die ekeln sich vor dem eigenen Handy. Der Grund: Sie haben Angst vor Löchern - sie leiden an Trypophobie. Wenn dich dein Handy ekelt.
Mehr lesen
Lesezeit 5 Min.
Darmkrebs
Eine Darmspiegelung ist nichts wovor du dich fürchten musst. Denk daran: je früher Darmkrebs erkannt wird, umso besser sind deine Chancen. Geh vorsorgen!
Mehr lesen
Lesezeit 10 Min.
Tagträume
Unser Gehirn nutzt freie Sekunden zum Fantasieren.Tagträume sind persönliche Rückzugsorte, dort verbergen sich unbewusste Wünsche oder stille Sehnsüchte.
Mehr lesen
Lesezeit 7 Min.
Sepsis
Eine Sepsis ist mehr als nur eine Kleinigkeit, denn sie kann lebensgefährlich werden. Wir zeigen dir die ausgelösten Symptome und was du da tun kannst.
Mehr lesen
Lesezeit 9 Min.
Krampfadern
Viele Frauen trauen sich nicht, Shorts oder kurze Röcke zu tragen. Schuld daran sind Krampfadern. Was du dagegen tun kannst, liest du hier. #freeyourlegs
Mehr lesen